Die Persönlichkeitsmerkmale eines Menschen setzen sich aus vielen verschiedenen Faktoren zusammen. Grundsätzlich unterteilt man dabei aber schon lange in introvertiert und extrovertiert (wissenschaftlich auch extravertiert); die Unterscheidung und Bezeichnung geht auf den Schweizer Psychoanalytiker Carl Gustav Jung und sein 1921 erschienenes Werk „Psychologische Typen“ zurück. Die Begriffe werden oft als Gegensatz zueinander verstanden und beschreiben dabei die zwei Enden einer Skala. Das stimmt auch in Teilen, da sich beide Begriffe auf den Persönlichkeitsfaktor der sogenannten „Extraversion“ beziehen. Dabei leiten sich die Bezeichnungen aus dem Lateinischen ab, in dem „intro“ so viel bedeutet wie „hinein“ und „extra“ dagegen mit „heraus“ übersetzt wird. „Vertere“ bedeutet hingegen „wenden“.
Das Maß an Extraversion auf der erwähnten Skala ist wichtig für das Verhalten einer Person in einem sozialen Umfeld. Extrovertierten Menschen wird nachgesagt, dass sie die Gesellschaft anderer Personen genießen und Kraft aus dem sozialen Kontakt ziehen. Das hat zur Folge, dass Personen, die auf andere offen, herzlich und gesellig wirken, oft auch als extrovertiert beschrieben werden. Introvertierte Menschen hingegen verbringen ihre Zeit dieser Theorie zufolge lieber allein oder mit ausgewählten Personen. Lange galt deshalb das Vorurteil, dass introvertierte Menschen zwangsläufig schüchtern und zurückhaltend seien. Das stimmt allerdings nur bedingt. Grob gesagt kann man aber festhalten, dass Extrovertierte ihre Energie eher nach außen richten, während sie bei Introvertierten ins Innere abzielt.
Oft kann man eine Person aber auch nicht einfach klar zu einer der beiden Seiten zuweisen. Stattdessen bewegen sie sich, um beim Bild der Skala zu bleiben, auf verschiedenen Studen der Extraversion. Der US-amerikanische Psychiater Rami Kaminski bringt auch deshalb einen weiteren Persönlichkeitstyp ins Gespräch, den viele noch nicht kennen: den sogenannten otrovertierten Typ. Doch was genau zeichnet ihn aus und wie findet man heraus, ob man dazu gehört?
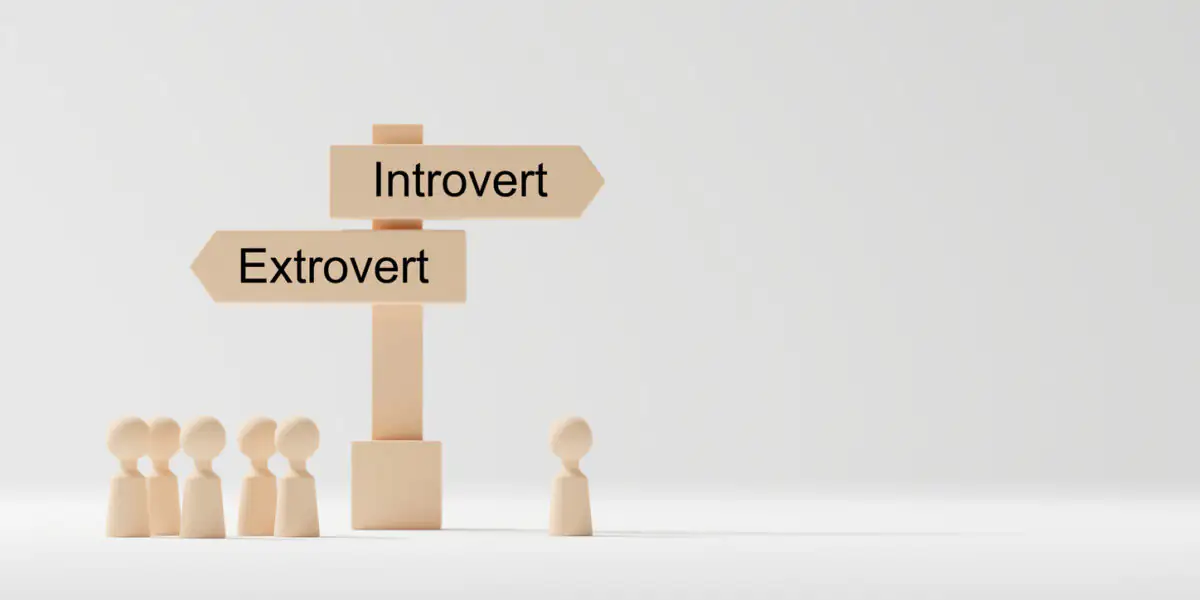
Weder introvertiert noch extrovertiert – aber vielleicht otrovertiert
Seine Theorie baute Kaminski auf der Beobachtung auf, dass viele seiner Klientinnen und Klienten nicht wirklich in einen der beiden beschriebenen Typen passen wollten. Und auch bei sich selbst stellte er das fest. Um seine Beobachtungen wissenschaftlich zu untermauern, arbeitete der Psychiater mit einem Biostatistiker zusammen, mit dem er unter anderem einen Fragebogen entwickelte, um über eine sogenannte „Otherness Scale“, also eine „Skala der Andersartigkeit“, bestimmte Muster zu erkennen. Bereits 2023 gründete er darauf aufbauend das „Otherness Institute“, das sich ganz der Forschung von Otrovertierten oder auch Otroverts widmet. Dabei haben otrovertierte Menschen sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede zu den anderen Persönlichkeitstypen.
Auch interessant: Was es aussagt, wenn man immer nur schwarze Kleidung trägt
Ein wesentlicher Unterschied besteht bereits in der Herangehensweise. Denn während sich Extro- und Introvertiertheit auf die Interaktion mit anderen Menschen konzentriert, konzentriert sich Kaminski auf einen dritten Typ abseits dessen. Solche Personen müssen sich weder aus einer Gruppe zurückziehen, um Kraft zu tanken, noch gibt es ihnen per se Energie, mit einer Gruppe zu interagieren. „Es ist nicht die Gruppe, die sie erschöpft – es ist die Konfrontation mit dem Gruppendenken“, erklärt der Psychiater. Otrovertierte seien deshalb eigenständiger und stünden oft am Rande einer Gemeinschaft; immer noch Teil davon, allerdings unabhängig. Im „Guardian“ beschreibt Kaminski diese Personen als „Solisten, die nicht in einem Orchester spielen können“.

Otrovertierte sind oft unangepasst und kreativ
Otrovertierte zeichnen sich dem Experten zufolge durch ein hohes Maß an Eigenständigkeit und dem Bedürfnis nach Ruhe aus, weshalb man sie auf den ersten Blick auch für introvertiert halten könnte. Oft treten sie dabei selbstbewusst und vor allem selbstbestimmt auf, wobei sie so lange gesellig sind, wie sie ihre Unabhängigkeit wahren können. Wenn sie ein Gespräch suchen, dann eher am Rande einer Gruppe und oft gezielt mit einer Person. Solche Gespräche, am besten in einer ruhigen Umgebung geben Otrovertierten durchaus auch Energie, während dieselbe Situation einen Introvertierten meistens genauso auslaugen würde wie einen Extrovertierten.
Dafür haben Otrovertierte oft ein Problem mit gesellschaftlichen Zwängen, Ritualen, Regeln und genereller Anpassung. Das hat häufig zur Folge, dass sie anecken und von anderen Personen als unangepasst wahrgenommen werden. Als historische Beispiele für Otrovertiertheit nennt Rami Kaminskietwa Frida Kahlo oder Albert Einstein.
Wer feststellen möchte, ob man selbst zu den otrovertierten Personen gehört, kann das wie bei anderen Persönlichkeitstypen auch etwa über den Fragebogen des Instituts tun. Dabei soll man nicht unbedingt Fragen beantworten, sondern vielmehr bestimmten Aussagen in verschiedenen Abstufungen zustimmen oder widersprechen. Dazu gehören Sätze wie „Ich habe nur sehr wenige Menschen in meinem Leben, denen ich wirklich nahe stehe“, „Ich fühle mich bei großen gesellschaftlichen Zusammenkünften einsam“ oder „Ich betrachte Nachdenken als eine Aktivität“.
